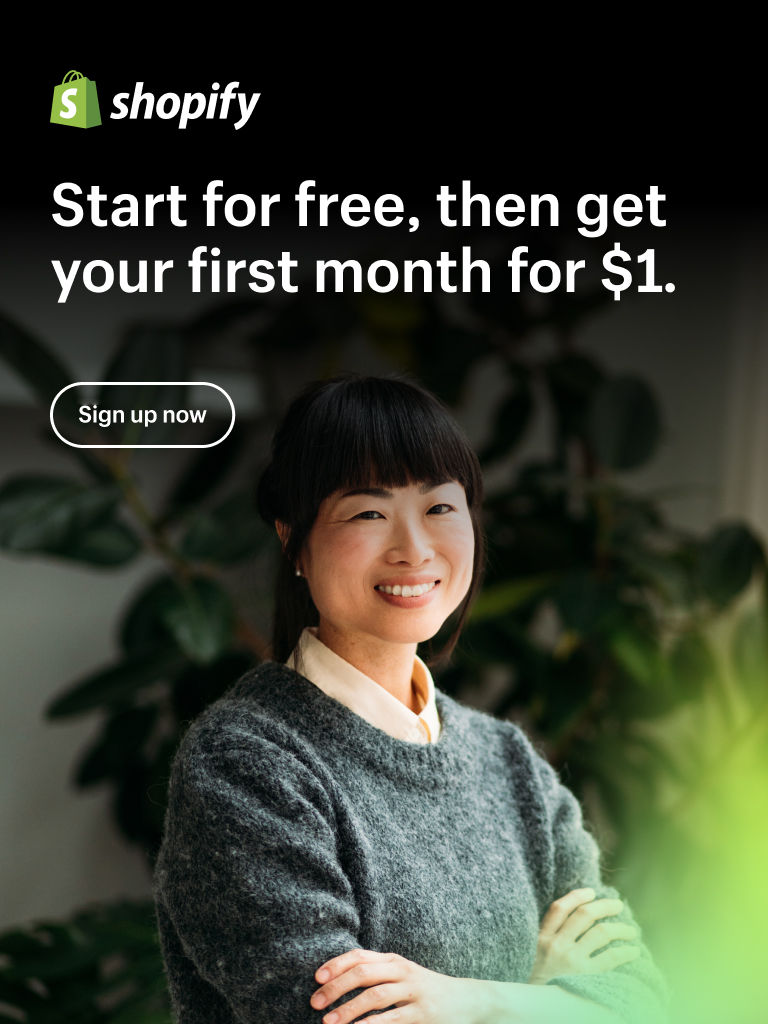Physiologische Herausforderung: Hypoxie in der Höhe
Der Aufstieg in größere Höhen stellt unseren Organismus vor eine enorme physiologische Herausforderung. Mit zunehmender Höhe sinkt der barometrische Druck und damit auch der Sauerstoffpartialdruck (pO2). Dieser Zustand wird als Hypoxie bezeichnet – ein Mangel an Sauerstoff im Gewebe. Um diese Herausforderung zu meistern, aktiviert der Körper eine komplexe Kaskade von Anpassungsmechanismen.

Akute Phase: Schnelle Reaktion des Körpers
Innerhalb der ersten Stunden am Berg reagiert der Körper mit unmittelbaren kompensatorischen Mechanismen:
-
Hyperventilation: Die Chemorezeptoren im Aortenbogen und der Halsschlagader registrieren den sinkenden
pO2
und stimulieren das Atemzentrum im Gehirn. Dies führt zu einer erhöhten Atemfrequenz und -tiefe, um die Sauerstoffaufnahme in der Lunge zu maximieren. - Kardiale Antwort: Das Herzzeitvolumen wird durch eine Steigerung der Herzfrequenz erhöht, um den zirkulierenden Sauerstoff schneller zu den peripheren Geweben zu transportieren.
- Flüssigkeitsverschiebung: Der Körper verlagert Wasser aus dem intravasalen (Blutplasma) in den extravasalen Raum, was zu einer vorübergehenden Hämokonzentration führt und die relative Konzentration der Erythrozyten (rote Blutkörperchen) erhöht.
Akklimatisierung: Langfristige strukturelle Anpassungen
Nach einigen Tagen beginnt die Akklimatisierung, eine tiefgreifende physiologische Umstrukturierung:
- Erythropoese: Die Nieren schütten als Antwort auf die Hypoxie vermehrt das Hormon Erythropoetin (EPO) aus. Dies stimuliert die Hämatopoese im Knochenmark, was zu einer erhöhten Produktion von Erythrozyten führt. Ein Anstieg des Hämatokritwerts und der Hämoglobin-Konzentration verbessert die Sauerstofftransportkapazität des Blutes signifikant.
- Angiogenese: Im Muskelgewebe kommt es zur Kapillarisierung – der Neubildung von Kapillaren. Dies verkürzt die Diffusionsstrecke für Sauerstoff zwischen den Blutgefäßen und den Myozyten (Muskelzellen).
- Zelluläre Ebene: Die Dichte der Mitochondrien, den „Kraftwerken“ der Zellen, steigt an. Zudem wird die Effizienz der Sauerstoffextraktion aus dem Blut verbessert, was eine optimierte aerobe Energieproduktion ermöglicht.
Diese Anpassungen sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit. Eine sorgfältige Akklimatisationsstrategie minimiert das Risiko einer akuten Höhenkrankheit und ermöglicht es dem Körper, die physiologischen Vorteile der Höhenanpassung voll auszuschöpfen.

Schlaf in den Bergen – Warum nächtliche Regeneration auf 2.000 Metern anders funktioniert
Der Einfluss der Höhe auf den Schlaf
Schlaf ist eine der wichtigsten Regenerationsphasen für Alpinisten. Doch in größeren Höhen verändert sich das Schlafmuster deutlich. Hypoxie führt zu häufigeren Aufwachreaktionen, einem reduzierten Tiefschlafanteil und teilweise sogar zu periodischer Atmung in der Nacht. Diese Faktoren können die körperliche und mentale Erholung erheblich beeinträchtigen.

Strategien für besseren Schlaf in alpinen Regionen
Eine gute Schlafhygiene ist daher besonders wichtig: angepasste Flüssigkeits- Mahlzeiten- und Mikronährstoffzufuhr vor dem Schlafen, ausreichend warme Kleidung sowie der Verzicht auf Alkohol und Koffein. Auch eine schrittweise Akklimatisation senkt die Wahrscheinlichkeit von Schlafstörungen. Wer auf ausreichenden und qualitativ hochwertigen Schlaf achtet, schafft die Basis für eine bessere Regeneration, ein starkes Immunsystem und anhaltende Leistungsfähigkeit in den Bergen.
Autorin: Laura Bahmann
Quellen:
- West, J. B. (2012). High-Altitude Medicine and Physiology. Oxford University Press.
- Levine, B. D., & Stray-Gundersen, J. (1997). "Living high-training low": effect of altitude acclimatization with intermittent hypoxic exposure on training and athletic performance. Journal of Applied Physiology, 83(1), 102-112.
- Pugh, L. G. C. E. (1962). Physiological and medical aspects of the 1960-61 Himalayan Scientific and Mountaineering Expedition. British Medical Journal, 2(5318), 1362.